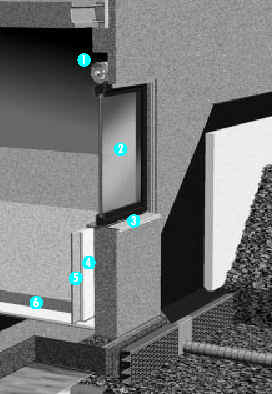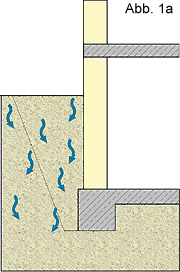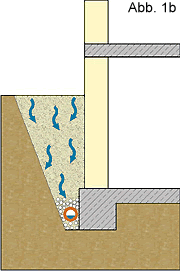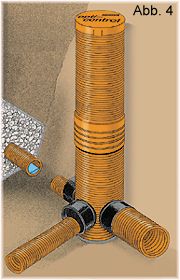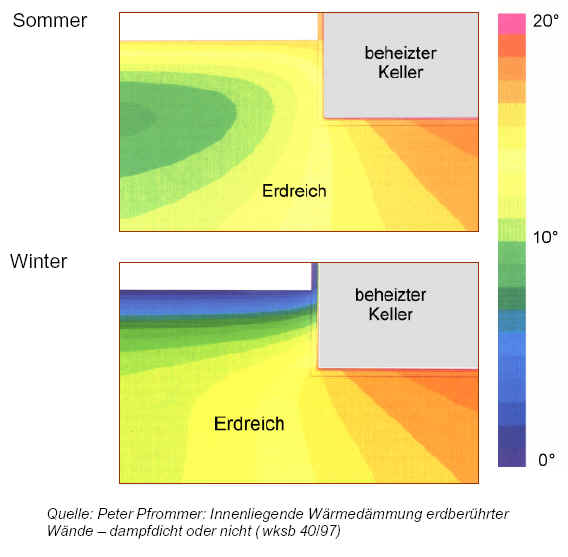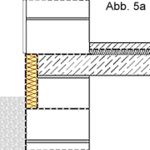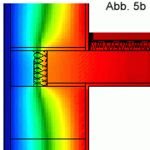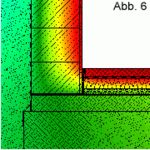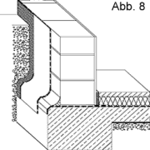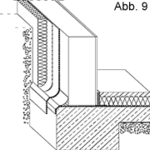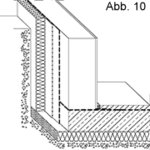| Überarbeitet 27.10.2002 |
Keller im Passiv -Energiehaus
|
Der Keller und die Energie-Einsparverordnung
Ausreichende Nebenflächen unterscheiden ein Haus von einer Etagenwohnung.
Keller bieten preiswerte Flächen für hochwertig genutzte Nebenräume.
Arbeitszimmer, Hauswirtschaftsraum, Spielfläche für Kinder, Platz für Fitness
und Hobbys sind hier gut untergebracht. Sie benötigen eine auf Dauer wirksame
Abdichtung und eine heutigen Energiesparanforderungen angemessene Wärmedämmung.
Im August 2000 erschien die Neufassung der DIN 18195
"Bauwerksabdichtungen", im März 2001 wurde die neue
Energie-Einsparverordnung (EnEV) vom Bundeskabinett verabschiedet. Sie berücksichtigt
beim Wärmeenergienachweis vorhandene Lüftungsanlagen, vor allem mit Wärmerückgewinnung,
und die Gewinnung von Energie aus Sonneneinstrahlung. Die dafür erforderlichen
Speicher und Aggregate benötigen frostsichere Flächen, die preiswert im Keller
vorhanden sind.
Bauwerksabdichtungen
Hochwertig genutzte Keller müssen dauerhaft gegen Feuchtigkeit aus dem
Erdreich geschützt sein. Die Anforderungen an die Abdichtung richten sich nach
der Feuchtebelastung. Die im August 2000 veröffentlichte Neufassung von DIN
18195 - 4 stuft die Lastfälle der Feuchtebelastung neu ein. Sie unterscheidet
jetzt zwischen Bodenfeuchtigkeit, nichtstauendem Sickerwasser, vorübergehend
aufstauendem Sickerwasser und drückendem Wasser. Zusätzlich nimmt sie
kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtungen sowie kalt selbstklebende
Abdichtungsbahnen auf.
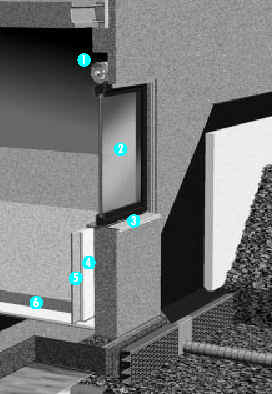 |
1) Rolladen
mit Wandaussparung
2)
Isolierglasfenster
3) Fensterbank
außen (Alu)
4) Wärmedämmung
mit Styropor, Steinwolle, Kork
oder ähnliche
geeignete Materialien
5) Verkleidung
z.B. Gipskartonplatten, Nut- u.
Federbretter auf Lattung mit
Hinterlüftung (Trockenausbau)
auch für Deckenunterseite geeignet
6) Estrich mit
Wärmedämmung (schwimmender
Estrich)
|
| Quelle: Josef Raab GmbH Neuwied |
|
Bodenfeuchtigkeit u. nichtstauendes
Sickerwasser
Dieser Lastfall ist anzunehmen, wenn das Baugelände bis zu ausreichender
Tiefe unter der Fundamentsohle und auch das Verfüllmaterial der Arbeitsräume
aus nichtbindigen Böden (Sand, Kies, Splitt) besteht (Abb. 1a). Feuchtigkeit
versickert ohne Aufstau. Um Schichten- u. Hangwasser sicher abzuführen, ist bei
bindigem Boden eine Dränage nach DIN 4095 erforderlich (Abb. 1b). Deren
Funktionsfähigkeit muss auf Dauer sichergestellt sein. Diese Regelung ist neu,
denn in der alten Fassung der Norm wurde einer Dränage nicht zugestanden,
langfristig diesen Lastfall zu gewährleisten.
Drückendes Wasser
Ohne funktionierende Dränage ist bei Hang- oder
Schichtenwasser von zeitweilig aufstauenden Sickerwasser auszugehen (Abb. 2a).
Randbedingung sind
- Gründungstiefen bis 3,0 m unter Geländeoberkante
- Unterkante Kellersohle mindestens 0,3 m über dem langfristig beobachteten
Grundwasserstand.
Steht das Gebäude dauernd im Grundwasser, bestimmt der
Lastfall "von außen drückendes Wasser" das Abdichtungssystem (Abb.
2b). Unabhängig von Gründungstiefe, Eintauch- und Bodenart, gilt er nicht nur
bei Grundwasser, sondern auch bei Schichtenwasser und stauendem Sickerwasser.
Abdichtungssysteme
Für die Abdichtung gemauerter Keller im Wohnungsbau sind
kunststoffmodifizierte Bitumen-Dickbeschichtungen, kalt selbstklebende
Bitumenbahnen und verschiedene Varianten von heiß verklebten Bitumenbahnen üblich.
Bei drückendem Wasser sind Abdichtungen mit heiß verklebten Bitumenbahnen
("schwarze Wanne") eine Alternative zur "weißen Wanne" aus
wasserundurchlässigem Beton.
Da DIN 18195 jetzt alle Abdichtungssysteme regelt, endet die Rechtsunsicherheit,
ob in DIN 18195 nicht geregelte Produkte den anerkannten Regeln der Technik
entsprechen. Bauunternehmer können damit unbedenklich kunststoffmodifizierte
Bitumen-Dickbeschichtungen einsetzen.
Kunststoffmodifizierte Bitumen-Dickbeschichtungen
Bitumen Dickbeschichtungen sind für die Lastfälle Bodenfeuchtigkeit (bei
bindigen Böden mit Dränage) und zeitweilig anstauendes Sickerwasser zulässig.
Der Auftrag (Abb. 3) erfolgt durch Spachteln oder Spritzen. Um eine gleichmäßige
Schichtdicke zu gewährleisten, ist das Material ist in zwei Arbeitsgängen
aufzutragen. Die Trockenschichtdicke muss im Lastfall Bodenfeuchtigkeit 3 mm,
bei zeitweilig anstauendem Sickerwasser 4 mm betragen. Bei zeitweilig
anstauendem Sickerwasser ist auf die erste Lage ein Gewebe einzuarbeiten.
Da Bitumendickbeschichtungen unter Druck kriechen, sind Fehlstellen im
Untergrund (Ausbrüche, offene Fugen) vor dem Auftrag der Abdichtung zu schließen.
Bitumen ist als Putzgrund ungeeignet. Deshalb wird empfohlen, statt eines
Bitumenauftrags im Spritzwasserbereich eine flexible Dichtungsschlämme
aufzutragen.
Kaltverklebende Bitumen Kautschukbahnen
Diese Dichtungsbahnen eignen sich für den Lastfall "Bodenfeuchte"
. Ein kaltflüssiger Voranstrich dient als Untergrundvorbereitung. Die rückseitige
Trägerfolie ist bei Aufbringen der Bahn schrittweise abzuziehen. Überlappungen
sind mit einer Gummirolle sorgfältig nach zu arbeiten. Am oberen Rand ist die
Bahn mit einer Kappleiste oder Putzabschlussschiene mechanisch zu sichern.
Drainage
Die Neufassung von DIN 18195 wertet die Dränage auf. Bei
bindigem Boden darf jetzt vom Lastfall Bodenfeuchtigkeit ausgegangen werden,
wenn
- eine Dränung nach DIN 4095 vorhanden ist, und
- deren Funktionsfähigkeit auf Dauer gegeben ist.
Die Flächendränage an der Wand und die Ringdränage (Abb. 4)
am Fundament sind in entsprechender Qualität auszuführen. Dazu gehören auch
|
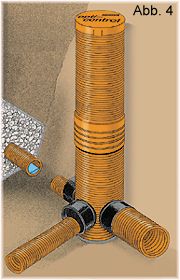 |
- funktionsfähige Vorflut sicherstellen
- Kontrollschächte vorsehen
- jährlich die Funktionsfähigkeit der Dränung kontrollieren
|
Für Flächendränagen eignen sich Dränplatten aus bituminös verklebten
Polystyrolkugeln oder Dränmatten aus Kunststoff-Noppenbahnen. Wegen ihrer
einfachen und kostengünstigen Verlegung bestehen Ringdränagen heute vor allem
aus perforierten PVC-Rohren. Die hydraulische Bemessung einer Dränung erfordert
die Kenntnis der Bodenverhältnisse und der anfallenden Wassermenge. DIN 4095
gibt für den Regelfall Richtwerte an. Bei abweichenden Grenzwerten ist eine
genaue Berechnung unabdingbar. Für sie steht heute PC-Software zur Verfügung.
|
Einflußgröße / Bauteil
|
Richtwert
|
|
Gelände
|
eben bis leicht geneigt
|
|
Durchlässigkeit des Bodens
|
schwach durchlässig
|
|
Einbautiefe
|
bis 3 Meter
|
|
Gebäudehöhe
|
bis 15 Meter
|
|
Länge der Dränleitung zwischen Hoch- und Tiefpunkt
|
bis 60 Meter
|
|
Dränleitung
|
Nennweite größer DN 100; Gefälle Größer 0,5 %
|
|
Kontrollschacht
|
Nennweite größer DN 100
|
|
Spülschacht
|
Nennweite DN 300
|
|
Übergabeschacht
|
Nennweite DN 1000
|
Wärme- und Tauwasserschutz
Beheizte Keller unterliegen der Wärmeschutz- bzw. in Zukunft der
Energieeinsparverordnung. Der Nachweis des baulichen Wärmeschutzes nach dem
Energiebilanzverfahren schreibt zwar keinen k-Wert (in Zukunft U-Wert) für
Kellerwände vor. Er sollte dennoch nicht zu niedrig sein, weil warme Wände und
Decken vor Tauwasserniederschlag schützen. Da im Sommer die Wärmezufuhr in die
Kellerräume (Heizung abgestellt oder nur auf Warmwasserbetrieb) und die Wärmeabgabe
moderner Heizungen sehr gering ist, sollte die Wärmedämmung von Kellersohle
und -wänden nicht ungünstiger als 0,5 W/m²K sein. Um Tauwasserniederschlag
auf den Oberflächen vorzubeugen, ist auch bei unbeheizten Kellern ein Mindestwärmeschutz
zu empfehlen.
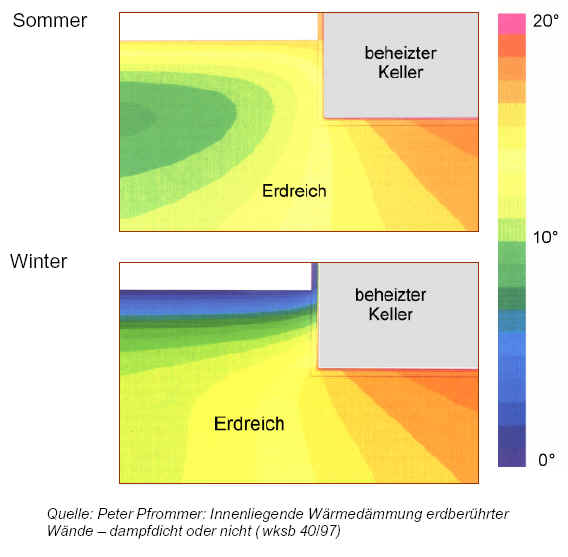
Tauwasserbildung auf
Bauteiloberflächen
Sinkt die Temperatur auf der Wand- oder Deckenoberfläche unter einen
kritischen, von der relativen Luftfeuchtigkeit abhängigen Wert, erreicht der
Wasserdampf in der Luft seinen Taupunkt. Er kann sich als Tauwasser auf den
kalten Oberflächen niederschlagen. Geschieht dies häufiger, bildet sich
Schimmel. Die Entwurfsfassung von DIN 4108 - 2 von Juni 1999 geht sogar davon
aus, daß Schimmel nicht erst bei häufigem Erreichen des Taupunktes, sondern
bereits bei häufigem Erreichen einer relativen Luftfeuchtigkeit von 80 %
auftritt. Die Gefahr von Schimmel ist beim Keller eher im Sommer als während
der Heizperiode zu sehen.
Die rechnerische Beurteilung ist im Regelfall des Tauwasserausfalles ist sehr
aufwendig, weil die Randbedingungen nach DIN 4108 (Glaser-Verfahren) anzupassen
sind:
- durch Dämmwirkung des Erdreichs herrschen andere Temperaturdifferenzen
- die Temperaturdifferenzen verändern sich mit der Wandhöhe
- es gelten andere Zeiten für die Kondensations- und Austrocknungsperiode.
- Wasserdampfdiffusion erfolgt nur nach innen
Bei wohnraumähnlicher Nutzung mit entsprechend geringer
Feuchtebelastung und Raumtemperaturen sind nach der Wärmeschutzverordnung bzw.
Energieeinsparverordnung ausreichend wärmegedämmte Kellerwände nicht
tauwassergefährdet. Ist mit hohem Feuchteanfall im Keller zu rechnen, sind
jedoch genauere Untersuchungen notwendig.
Wärmebrücken
Besondere Beachtung finden in der Energieeinsparverordnung die Wärmebrücken.
Untersuchungen zeigen, dass Wärmebrücken bei hoch gedämmten Konstruktionen
einen Anteil von bis zu 20 % der Transmissionswärmeverluste haben können.
Setzt man diese grob mit 45 % der Gesamtenergieverluste an, verlieren Wärmebrücken
bis zu 9 % des Gesamtenergiebedarfes. Ein Anteil, der bei dem
Genauigkeitsanspruch des Nachweises nicht zu vernachlässigen ist. Die
Energieeinsparverordnung sieht drei Wege zur Erfassung von Wärmebrücken vor:
- pauschaler Zuschlag eines Wärmebrückenkoeffizienten DUWB = 0,1 W/m²K
auf alle Außenbauteile.
- Ausführung der Details entsprechend Beiblatt 2 zur DIN 4108. Sie gelten
als "wärmebrückenarm". Bei Beachtung dieser Empfehlungen darf
der Zuschlag auf den Wärmebrückenkoeffizienten DUWB halbiert werden.
- Berücksichtigung des tatsächlichen Wertes als längenbezogener Wärmedurchgangskoeffizient
Y. Dieser Wert ist zu berechnen oder aus Wärmebrückenkatalogen zu
entnehmen.
An Wärmebrücken treten nicht nur erhöhte Wärmeverluste
auf, sondern es sinken auch die innenseitigen Oberflächentemperaturen.
Unterschreiten sie die Taupunkttemperatur, kommt es zum Tauwasserausfall.
Besonders kritische Stellen sind im Untergeschoss
- Kellerecken
- Übergang Wand/Sohle
- Laibungen Kellerfenster
- Auflager Kellerdecke
Tauwasserbildung auf
Bauteiloberflächen
Sinkt die Temperatur auf der Wand- oder Deckenoberfläche unter einen
kritischen, von der relativen Luftfeuchtigkeit abhängigen Wert, erreicht der
Wasserdampf in der Luft seinen Taupunkt. Er kann sich als Tauwasser auf den
kalten Oberflächen niederschlagen. Geschieht dies häufiger, bildet sich
Schimmel. Die Entwurfsfassung von DIN 4108 - 2 von Juni 1999 geht sogar davon
aus, daß Schimmel nicht erst bei häufigem Erreichen des Taupunktes, sondern
bereits bei häufigem Erreichen einer relativen Luftfeuchtigkeit von 80 %
auftritt. Die Gefahr von Schimmel ist beim Keller eher im Sommer als während
der Heizperiode zu sehen.
Die rechnerische Beurteilung ist im Regelfall des Tauwasserausfalles ist sehr
aufwendig, weil die Randbedingungen nach DIN 4108 (Glaser-Verfahren) anzupassen
sind:
- durch Dämmwirkung des Erdreichs herrschen andere Temperaturdifferenzen
- die Temperaturdifferenzen verändern sich mit der Wandhöhe
- es gelten andere Zeiten für die Kondensations- und Austrocknungsperiode.
- Wasserdampfdiffusion erfolgt nur nach innen
Bei wohnraumähnlicher Nutzung mit entsprechend geringer
Feuchtebelastung und Raumtemperaturen sind nach der Wärmeschutzverordnung bzw.
Energieeinsparverordnung ausreichend wärmegedämmte Kellerwände nicht
tauwassergefährdet. Ist mit hohem Feuchteanfall im Keller zu rechnen, sind
jedoch genauere Untersuchungen notwendig.
Wärmebrücken sind mehrdimensionale physikalische Probleme.
Ihre Auswirkung können nur mit Computern analysiert werden. Für die Praxis
enthalten Beiblatt 2 zur DIN 4108 oder Wärmebrückenatlanten Beispiele wärmebrückenarmer
Konstruktionen.
Wärmeschutz entsprechend der Energieeinsparverordnung wird
sowohl mit gemauerten Kellerwänden aus wärmedämmenden Steinen (Abb. 8) als
auch mit Betonwänden oder gemauerten Wänden aus Steinen hoher Rohdichte bei
Verwendung einer Perimeterdämmung (Abb. 9). Zusätzlich ist natürlich auch der
Kellerboden zu dämmen. Die Dämmung des Kellerbodens kann auf der Kellersohle
unter dem Estrich oder unter der Bodenplatte erfolgen. Im Hinblick auf
Minimierung der Wärmebrücken ist die Verwendung einer lastabtragenden Wärmedämmung
ideal, die auch unter den Fundamenten angeordnet werden darf (Abb. 10).
Bei Dämmung auf der Bodenplatte werden an den Dämmstoff
keine besonderen Anforderungen gestellt. Da Dämmstoff außerhalb der Abdichtung
ungeschützt der Feuchtigkeit und dem Erdruck ausgesetzt ist, benötigt er eine
bauaufsichtliche Zulassung als Nachweis der langfristigen Brauchbarkeit. Dies
gilt auch für lastabtragende Wärmedämmung.
Die empfohlene Dämmstoffdicke beträgt, beim Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit
von (lR = 0,04 W/mK) 80 mm bis 120 mm. Geeignete Produkte sind z. B.
- Polystryrol-Extruderschaumplatten nach DIN 18164-1, Typ WD und WS. Sie
sind im Grundwasser bis 3,5 m Tauchtiefe und bis zu einer Dicke von 120 mm
zulässig.
- Polystyrol-Partikelschaum nach DIN 18164-1, Typ WS, Mindestrohdichte 30
kg/m³. Bei ständig oder lang anhaltendem drückenden Wasser ist
Polystyrol-Partikelschaum ungeeignet.
Einbau der Perimeterdämmung
Bindiger Füllboden kann mit den Wärmedämmplatten verkleben. Beim Setzen
entstehen Verschiebungskräfte, die die punktweise Montageverklebung der Dämmplatten
an der Abdichtungsschicht nicht aufnehmen kann. Es besteht die Gefahr, dass die
Abdichtung von der Wand abgerissen wird. Dämmplatten sind daher auf dem
Streifenfundament kraftschlüssig abzusetzen, vollflächig zu verkleben oder mit
einer Trennlage vom Füllboden zu trennen. Die o.g. Dämmstoffe benötigen
keinen Schutz gegenüber der Baugrubenverfüllung. Im Grundwasser sind Dämmplatten
immer vollflächig zu verkleben, damit hinterlaufendes Wasser den Wärmeschutz
nicht verschlechtern kann.
Quellen: Initiative Pro Keller
Thermogrund auf
Schwedisch
www.bauweise.net