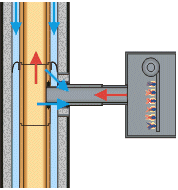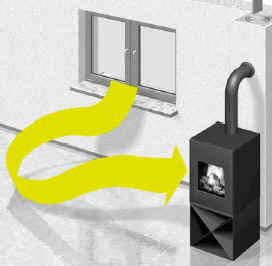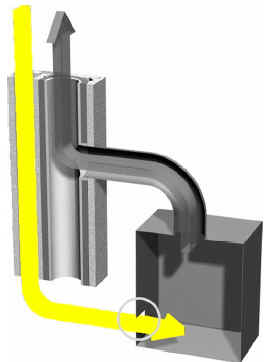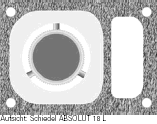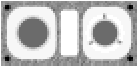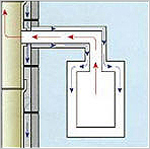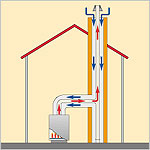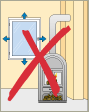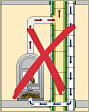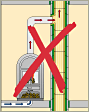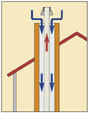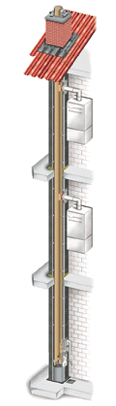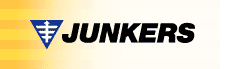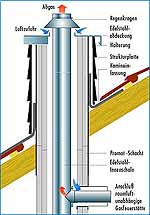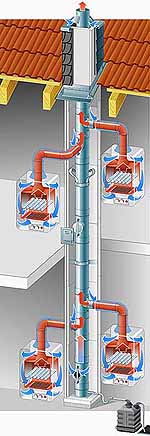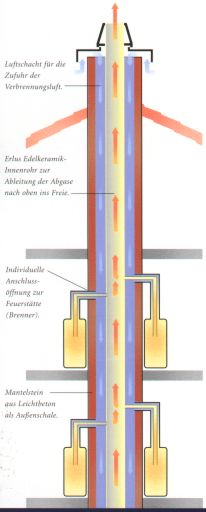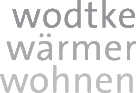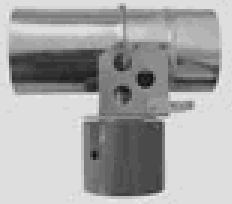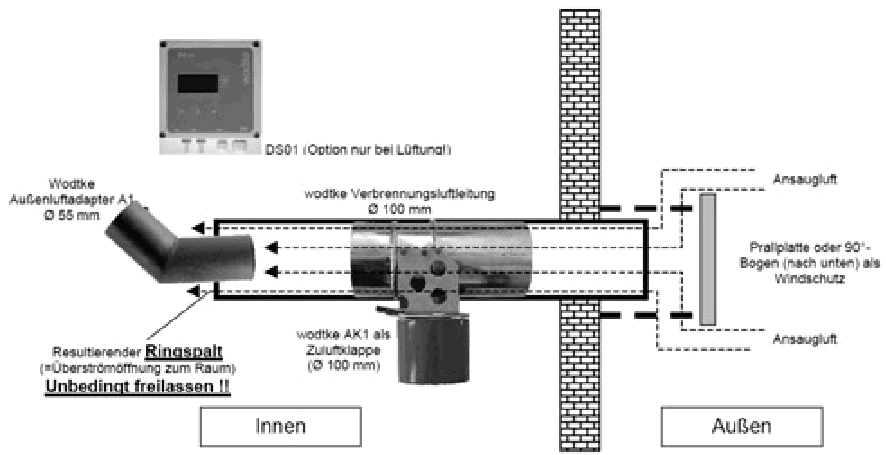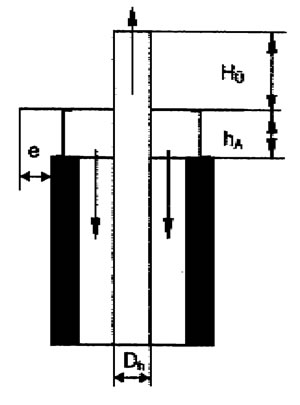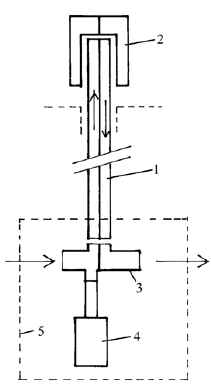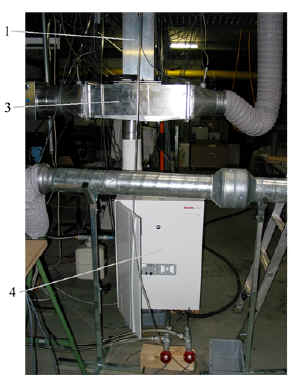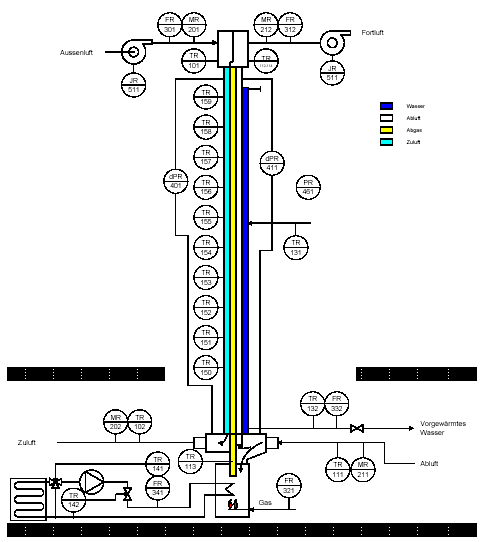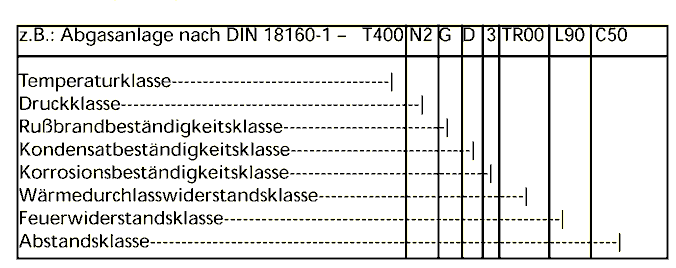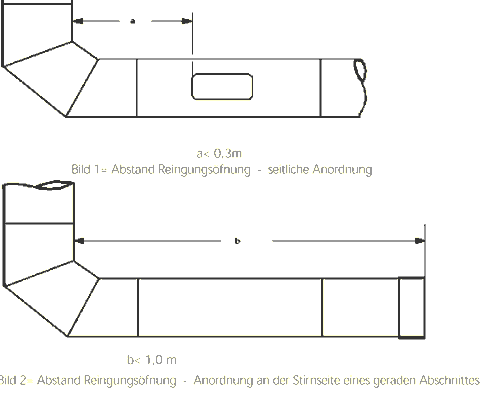DIN 18 160 Teil 1 „Abgasanlagen – Planung
und Ausführung“
Die DIN 18160 Teil 1 regelt erstmalig die
Verwendung von Bauprodukten für Abgasanlagen, die nach den entsprechenden
Europäischen Normen hergestellt werden. Verwendungsregeln für weitere
Bauprodukte für Abgasanlagen, für die es noch keine Europäischen Normen
gibt und die deshalb noch bestehenden nationalen Bauvorschriften und
nationalen Normen entsprechen, werden in dieser Norm ebenfalls festgelegt. Der
Begriff „Restnorm" trifft somit auf diese Ausgabe nicht mehr zu,
sondern man kann sie als so genannte nationale Ausführungsnorm bezeichnen.
Der Kreis, der NABau-Arbeitsausschuss 11.39.00 "Abgasanlagen", in
dem die Norm „Abgasanlage - Planung und Ausführung" erstellt wurde,
setzt sich aus Vertretern der Schornsteinindustrie, Interessenverbänden, Prüfstellen,
Deutschen Institut für Bautechnik, Behörden, DIN und zum guten Schluß aus
dem Schornsteinfegerhandwerk zusammen. Nach etwa 7 - jähriger
Bearbeitungszeit wurde die Norm mit Datum Dezember 2001 aufgelegt. Sie bietet
uns eine wichtige Grundlage für unsere tägliche Arbeit. Für die Abnahmetätigkeiten
aber auch für die Feuerstättenschau werden hier die relevanten
baurechtlichen Vorgaben für Abgasanlagen dargestellt.
Die Begriffe und Inhalte sind an das neue
Baurecht (Neufassungen der Bauordnungen und der Feuerungsverordnungen der
Bundesländer aufgrund der Europäischen Rechtslage) angepasst. Begriffe und
Definitionen in Europäischen Normen sowie in älteren nationalen Normen und
bauaufsichtlichen Dokumenten können deshalb von denen in der Norm
festgelegten Begriffen und Definitionen im Einzelfall abweichen. Diese Norm präzisiert
die Verwendung der Produkte im Sinne des neuen Baurechts. Zur leichteren
Identifikation und zur Erkennung der Verwendbarkeit der mit den Produkten
errichteten Bauwerke ist ein umfassendes Klassifizierungssystem angegeben.
Ferner werden die baulichen Ausführungsbestimmungen für Luft-/Abgassysteme
(LAS) und Abgasleitungen und deren Nutzung geregelt.
Die Bauordnungen und die dazugehörigen
Feuerungsverordnungen der Bundesländer können hinsichtlich der Abgasanlagen
einzelne, regional bedingte, unterschiedliche Festlegungen aufweisen. Die Norm
bezieht sich deshalb auf die Musterbauordnung und Muster-Feuerungsverordnung.
Für Abgasanlagen von Feuerstätten, die mit festen, flüssigen oder gasförmigen
Brennstoffen betrieben werden, sowie z. B. für die Abführung von Abgasen von
Wärmepumpen, Blockheizkraftwerken und ortsfesten Verbrennungsmotoren kann
diese Norm angewandt werden. Die DIN 18 160 Teil 2 Verbindungsstucke vom Mai
1989 tritt außer Kraft, weil jetzt in dieser neuen Norm die gesamte
Abgasanlage behandelt wird und Verbindungsstucke ein Teil von Abgasanlagen
gelten. Weiter wird die Verwendung von Bauprodukten für Abgasanlagen
geregelt. Abweichungen von den Ausführungen sind jederzeit möglich, sofern
eine gleichwertige Erfüllung der Anforderungen vorliegt.
Wichtige Inhalte zur Norm werden
hier im Nachgang beschrieben
Die DIN 18 160 Teil 1 wird 2002 als Ergänzungslieferung
zum Beuth „DIN-Normenordner für das Schornsteinfegerhandwerk" vom ZDS
ausgeliefert. Wer diesen Sammelordner für die wichtigsten Normen für das
Schornsteinfegerhandwerk bestellen mochte, kann dies beim DS-Verlag oder in
Bayern beim BS-Verlag tun.
Möglichkeiten der Abgasführung
Durch die Änderungen im Baurecht (Bauordnung
und Feuerungsverordnung der Länder) haben sich auch die bauaufsichtlichten
Schutzziele und die Begriffsdefinitionen geändert. Dabei geht man davon aus,
dass bei bestimmungsgemäßem Betrieb von Öl- und Gasfeuerungsanlagen kein Russbrand
mehr entsteht. Hiermit genügt es auch, dass die Abgasanlagen nur noch von
Feuerstätten ausgehenden Abgastemperaturen widerstehen. So hat man
bauaufsichtlicht eine klare Unterscheidung geschaffen. In diesem Falle handelt
es sich um Abgasleitungen. Im Gegensatz dazu spricht man von Schornsteinen,
wenn Feuerstätten für feste Brennstoffe angeschlossen sind und das
Abgassystem russbrandbeständig ausgebildet wurde. Im Punkt 3.
Begriffsbestimmung werden die zur Bearbeitung der Norm notwendigen Begriffe
aufgeführt, hier werden nur die wichtigsten:
Abgasanlage
aus Bauprodukten hergestellte bauliche Anlage,
wie Schornstein, Verbindungsstuck, Abgasleitung oder Luft-Abgas-System für
die Ableitung von Abgasen von Feuerstätten; zu den Abgasanlagen zählen auch
Anlagen zur Abführung von Verbrennungsgasen ortsfester Verbrennungsmotoren.
Schornstein
Abgasanlage, die rußbrandbeständig ist.
Abgasleitung
Abgasanlage, die nicht rußbrandbeständig
sein muss.
Schacht für Abgasleitungen
die Abgasleitung umschließende bauliche
Anlage.
Luft-Abgas-System
Abgasanlage mit nebeneinander oder ineinander
angeordnetem Schacht. Das Luft-Abgas-System führt der Feuerstätte
Verbrennungsluft über den Luftschacht aus dem Bereich der Mündung der
Abgasanlage zu und die Abgase über den Abgasschacht übers Dach ins Freie ab.
Senkrechter Teil der Abgasanlage
vom Baugrund oder von einem Unterbau ins Freie
führender Teil einer Abgasanlage. Diese Begriffsbestimmung musste aufgenommen
werden, weil sich die Abgasanlage aus dem Verbindungsstück und dem
senkrechten Teil der Abgasanlage, dem Schornstein oder Abgasleitung
zusammensetzt. Ein senkrechter Teil der Abgasanlage kann unter Umständen auch
schräggeführte Abschnitte enthalten.
Sohle
unterer Abschluss des senkrechten Teils der
Abgasanlage. Bei Schornsteinen und Abgasleitungen in der Bauart eines
Schornsteins ist die Sohle weiterhin der Boden des Sammelraums für die Rückstände
u.a. von Verbrennungsrückständen. Bei Abgasleitungen, bei denen der Übergang
vom waagerechten Teil der Abgasanlage (Verbindungsstück in den senkrechten
Teil z.B. über einen 90° -Bogen erfolgt, bildet die Unterseite des Bogens
die Sohle.
Klassifizierung, Verwendung und
Kennzeichnung von Abgasanlagen
Bauprodukte für Abgasanlagen werden je nach
Anwendungsbereich nach der nachstehenden Leistungskenngrößen klassifiziert:
Temperaturklasse
Die Temperaturklasse gibt an, bis
zu welcher Abgastemperatur das Bauprodukt/die ausgeführte Anlage einsetzbar
ist.
Temperaturklasse zulässige
Abgastemp. in °C
|
|
T080
T100
T120
T140
T160
T200
T250
T300
T400
T450
T600
|
kleiner gleich 80°
kleiner gleich 100°
kleiner gleich 120°
kleiner gleich 140°
kleiner gleich 160°
kleiner gleich 200°
kleiner gleich 250°
kleiner gleich 300°
kleiner gleich 400°
kleiner gleich 450°
kleiner gleich 600°
|
Druckklasse
Die Druckklasse, früher Gasdichtheitsklasse,
gibt an, welche Leckrate das Bauprodukt bei dem angegebenen Prüfdruck
aufweisen darf, für welche Betriebsweise das Produkt geeignet ist und wie das
Produkt verwendet werden darf.
| Klasse |
Leckrate in IxS-1xm2
|
Prüfdruck in Pa
|
Betriebsweise |
Verwendung |
|
N1
|
2,0
|
40
|
Unterdruck
|
im Gebäude / im Freien
|
|
N2
|
3,0
|
20
|
Unterdruck
|
im Gebäude / im Freien
|
|
P1
|
0,006
|
200
|
|
im Gebäude / im Freien
|
|
P2
|
0,120
|
200
|
|
|
|
H1
|
0,006
|
5000
|
|
im Gebäude / im Freien
|
|
H2
|
0,120
|
5000
|
|
|
Rußbrandbeständigkeitsklasse
Die Rußbrandbeständigkeitsklasse gibt an, ob
das Bauprodukt auch für eine rußbrandbeständige oder nur für eine rußbrandbeständige
Abgasanlage geeignet ist.
|
Rußbrand-klasse
|
Bauprodukte für
Montageabgasanlage |
Bauprodukte für
Systemabgasanlagen |
Abgasanlage
|
|
G
|
--
|
rußbrandbeständig
|
rußbrandbeständig
|
|
S
|
rußbrandbeständig
|
--
|
--
|
|
O
|
nicht rußbrandbeständig
|
nicht rußbrandbeständig
|
nicht rußbrandbeständig
|
Kondensatbeständigkeitsklasse
Diese Klasse gibt an, ob das Bauprodukt für
trockene (D) oder für feuchte Betriebsweise (W) geeignet ist.
Korrosionswiderstandsklasse
Die Korrosionsbeständigkeitsklasse gibt an, für
welche Brennstoffe das Bauprodukt ausreichend korrosionsbeständig ist.
|
Korrossionsbeständigkeitsklasse
|
Einsetzbar in Abgasanlagen für
folgende Brennstoffe
|
|
1
|
gasförmig
|
|
2
|
flüssig / gasförmig
|
|
3
|
fest / flüssig / gasförmig
|
Wärmedurchlasswiderstandsklasse
Die Wärmedurchlasswiderstandsklasse Tryy
besteht aus der Buchstabenkombination TR gefolgt von einer Zahl, die sich aus
dem Wärmedurchlasswiderstand eines Bauprodukts in m2 *K * W –1
multipliziert mit 100 abgerundet auf die nächste ganze Zahl ergibt.
Feuerwiderstandsklasse
Die Feuerwiderstandsklasse gibt die Zeitdauer
an, der das Bauprodukt bei Brandbeanspruchung widersteht. Bauprodukte für
Abgasanlagen werden entsprechend ihrer Feuerwiderstandsdauer in die
Feuerwiderstandsdauer L30 bzw. L90 eingestuft. Bauprodukte mit Klassifizierung
F30 bzw. F90 sind gleichwertig einzusetzen, sofern die Anschlüsse und
Verbindungen mit in die Prüfung einbezogen wurden.
|
Feuerwiederstandsklasse
|
Widerstandsdauer in Minuten
|
|
L00 bzw. F00
|
ohne Feuerwiderstandsdauer
|
|
L30 bzw. F30
|
mindestens 30
|
|
L90 bzw. F90
|
mindestens 90
|
Abstandsklasse
Die Abstandsklasse besteht aus dem Buchstaben
C gefolgt von einer Zahl, die den Abstand in mm angibt, der von den Außenflächen
der Abgasanlage zu angrenzenden Bauteilen aus oder mit brennbaren Baustoffen
mindestens einzuhalten ist. Abweichungen hiervon können gegenüber Bauteilen
aus oder mit brennbaren Baustoffen auftreten, die nur mit geringer Fläche an
die Abgasanlage angrenzen oder deren Wärmedurchlasswiderstand den Wert 2,5 *
m2 K * W –1 überschreitet.
Baustoffklasse
Die Baustoffklasse regelt die Brennbarkeit der
Baustoffe. Die Baustoffe werden nach ihrem Brandverhalten in folgende Klassen
eingeteilt:
|
Baustoffklasse
|
Benennung
|
|
|
nichtbrennbare Baustoffe a)
|
|
|
brennbare Baustoffe
schwerentflammbare Baustoffe a)
normalentflammbare Baustoffe
|
|
|
|
Kennzeichnung der Bauprodukte
Bauprodukte für Abgasanlagen müssen mit dem
CE-Zeichen oder dem Ü-Zeichen gekennzeichnet sein. Hiervon ausgenommen sind
Bauprodukte nach Liste C der Bauregelliste.
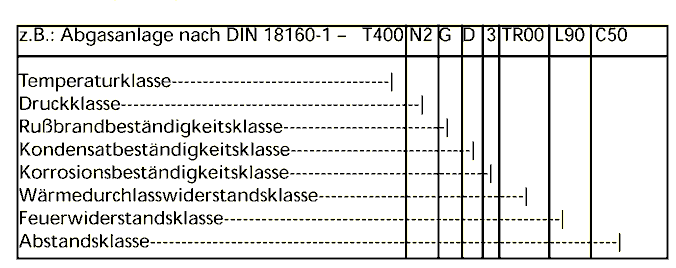
Kennzeichnung der ausgeführten
Anlage
Ausgehend von der Kennzeichnung der
verwendeten Bauprodukte und den Hinweisen in den Abschnitten 6 bis 9 ist die
Abgasanlage mindestens wie folgt zu kennzeichnen:
Abgasanlage nach DIN 18160-1 – Temperaturklasse, Druckklasse, Rußbrandbeständigkeitsklasse,
Kondensatbeständigkeitsklasse, Korrosionsbeständigkeitsklasse, Wärmedurchlasswiderstandsklasse
Feuerwiderstandsklasse und Abstandsklasse
Abgasanlagen
In der Norm kommt man zu nachfolgender
Festlegung.
Die Abgase von Feuerstätten müssen bei allen bestimmungsgemäßen
Betriebszuständen ordnungsgemäß ins Freie abgeführt werden. Dazu sind
Abgasanlagen in solcher Anzahl, Beschaffenheit und Lage herzustellen, dass die
vorgesehenen Feuerstätten in den Gebäuden ordnungsgemäß an Abgasanlagen
angeschlossen und betrieben werden können. An Abgasanlagen dürfen nur
ordnungsgemäß beschaffenen Feuerstätten angeschlossen werden, die durch
ihre Beschaffenheit oder durch ihre Ausrüstung sicherstellen, dass keine
explosionsfähigen Stoffe eingeleitet werden und keine höheren Anforderungen
auftreten können, als aufgrund der Klassifizierung der verwendeten
Bauprodukte und der Bezeichnung der Abgasanlage zulässig sind. Es muss
sichergestellt werden, dass die freie Beweglichkeit der Innenschale
mehrschaliger Abgasanlagen nicht behindert wird.
Brandschutz
Abgasanlagen sind so herzustellen, dass Feuer
und Rauch nicht in andere Geschosse oder Brandabschnitte übertragen werden können.
Die Übertragung
von Feuer und Rauch gilt als ausgeschlossen, wenn Abgasanlagen bei
Brandbeanspruchung von außen eine Feuerwiderstandsdauer von mindestens 90
Minuten aufweisen. Wenn an die Abgasanlage nur Feuerstätten für flüssige
und/oder gasförmige Brennstoffe angeschlossen sind, genügt in Wohgebäuden
geringer Höhe eine Feuerwiderstandsdauer von mindestens 30 Minuten.
Abgasanlagen müssen durchgehend sein; sie dürfen insbesondere nicht durch
Decken unterbrochen sein. Abgasanlagen müssen so wärmegedämmt oder so
angeordnet sein, dass durchströhmendes Abgas sowie gegebenenfalls Rußbrände
im Inneren einen Brand im Gebäude nicht auslösen können. Dies gilt
als erfüllt, wenn die Anforderungen an die Bauart und die Anforderungen an
die Abstände zu Bauteilen oder mit brennbaren Baustoffen eingehalten sind.
Schornsteine müssen unmittelbar auf dem Baugrund gegründet oder auf einem
feuerbeständigen Unterbau errichtet sein; es genügt ein Unterbau aus
nichtbrennbaren Baustoffen für Schornsteine in Gebäuden geringer Höhe, für
Schornsteine, die oberhalb der obersten Geschossdecke beginnen sowie für
Schornsteine an Gebäuden
Dichtheit
Aus den äußeren Wänden von Abgasanlagen
darf Abgas nicht in Gefahr drohender Menge austreten können.
Feuchteschutz
Der konstruktive Aufbau mehrschaliger
Abgasanlagen, insbesondere der Dampfdiffusionswiderstand der einzelnen
Schichten, sowie Anordnung Art und Dicke der Wärmedämmung müssen
sicherstellen, dass es zu keiner schädigenden Feuchteansammlung in den
Baustoffen kommt. Dies gilt sinngemäß auch für den
Dampfdiffusionswiderstand zusätzlicher äußerer Beschichtungen, nicht
hinterlüfteter Ummantelungen und nicht hinterlüfteter
Verkleidung, die Abgasanlagen großflächig bedecken.
Überprüfung
Abgasanlagen müssen leicht und sicher
gereinigt bzw. auf ihren freien Querschnitt hin überprüft werden können.
Dies wird in der Regel ermöglicht durch untere und gegebenenfalls obere
Reinigungsöffnungen, deren Unterkanten jeweils in einem Bereich von 0,4 –
1,4 m über einer Standfläche liegen. Die Anforderungen an die Standflächen
sind in DIN 18 160-5 geregelt. Schächte für Abgasleitungen, die wegen des
Betriebs mit Überdruck oder wegen der notwendigen Abstände zu brennbaren
Baustoffen hinterlüftet sein müssen sowie Schächte zur Verbrennungsluftzuführung
müssen überprüft werden können.
Bei der Ermittlung der Arbeitswerte und Gebühren für die Verordnung über
Schornsteinfegerarbeiten (Kehr- und Überprüfungsordnung) wurden bisher und
werden auch künftig die Mindestanforderungen der Norm zugrunde gelegt.
Sofern sich auf Grund von Abweichungen der Arbeitsaufwand für den
Schornsteinfeger erhöht, ist es denkbar, dass dieser zusätzliche
Arbeitsaufwand zu berücksichtigen ist. Der Gebrauch einfacher Werkzeuge
widerspricht nicht der genannten Anforderungen „leicht“. Diese Werkzeuge
gehören zu der Standartausrüstung eines Schornsteinfegers.
Anordnung der unteren Reinigungsöffnung
Die untere Reinigungsöffnung ist unterhalb
des untersten Feuerstättenanschlusses an der Sohle des senkrechten Teils der
Abgasanlage anzuordnen.
Bei Abgasleitungen darf die untere Reinigungsöffnung auch
- im senkrechten Teil der Abgasanlage direkt
oberhalb der Einführung des Verbindungsstückes oder
- seitlich im Verbindungsstück höchstens
0,3 m entfernt von der Umlenkung in den senkrechten Teil der Abgasanlage (siehe
Bild 1), oder
- - an der Stirnseite eines geraden
Verbindungsstückes höchstens 1,0 m entfernt von der Umlenkung in den
senkrechten Teil der Abgasanlage (siehe
Bild 2)
angeordnet werden.
Die genannten Abstände von 0,3 m bzw. 1,0 m werden von der dem Verbindungsstück
zugewandten Innenkante des senkrechten Teiles der Abgasleitung (abgasführendes
Teil) und der dem senkrechten Teil zugewandten Kante der Reinigungsöffnung
bzw. der Stirnfläche des geraden Verbindungsstückes gemessen.
Anordnung der oberen Reinigungsöffnung
Abgasanlagen, die nicht von der Mündung aus
gereinigt werden können, müssen eine weitere (obere) Reinigungsöffnung bis
zu 5 m unterhalb der Mündung haben.
Bei Abgasanlagen mit einem Abstand zwischen Mündung und unterer Reinigungsöffnung
von höchstens 5 m kann auf die obere Reinigungsöffnung verzichtet werden.
Schornsteine, die eine Schrägführung
- größer 15° zwischen der Achse und der
Senkrechten und
- einen seitlichen Versatz größer zweimal
dem hydraulischen Durchmesser des Schornsteines, gemessen von Achse zu
Achse aufweisen,
benötigen in einem Abstand von höchstens 1,0
m zu den Knickstellen der Reinigungsöffnungen.
Senkrechte Teile von Abgasleitungen, die eine Schrägführung größer 30°
zwischen der Achse und der Senkrechten aufweisen, benötigen in einem Abstand
von höchstens 0,3 m zu den Knickstellen der Reinigungsöffnungen
Bei größeren Schrägführungen bei
Unterdruck-Abgasanlagen bis 15° und einem entsprechenden seitlichen Veratz
lassen sich starke, feste Rußansätze
(z.B. Glanzruß), die ggf. besondere Reinigungsmaßnahmen (wie z.B.
Auskratzen, Ausschlemmen, Ausschlagen oder Ausbrennen) erfordern, nicht
mehr beseitigen oder evtl. Rußbrände nicht mehr beherrschen. Deshalb ist bei
Schornsteinen im Bereich von Knickstellen größer 15° mindestens
eine Reinigungsöffnung anzuordnen.
Ist die untere Reinigungsöffnung im
senkrechten Teil der Abgasanlage angeordnet, kann auf die obere Reinigungsöffnung
auch verzichtet werden,
wenn
- an die Abgasanlage nur Feuerstätten für
gasförmige Brennstoffe in derselben Nutzungseinheit (z.B. Wohneinheit,
Gewerbeeinheit) angeschlossen sind, und
- der hydraulische Durchmesser des
senkrechten Teils der Abgasanlage höchstens 0,20 m beträgt, und
- der senkrechte Teil der Abgasanlage höchstens
einmal bis zu 30 ° schräggeführt (gezogen) ist, und
- die untere Reinigungsöffnung nicht mehr
als 15 m von der Mündung entfernt ist.
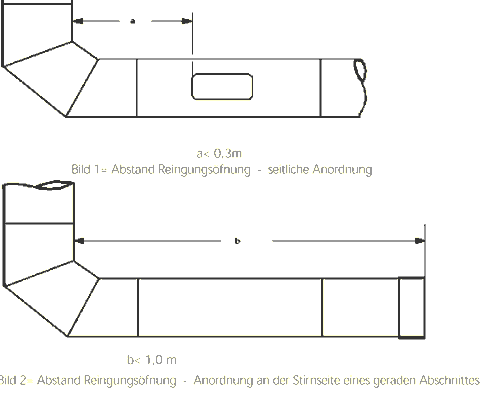
Ist die untere Reinigungsöffnung im
Verbindungsstück angeordnet, kann auf die obere Reinigungsöffnung auch
verzichtet werden, wenn
- an die Abgasanlage nur Feuerstätten für
gasförmige Brennstoffe in derselben Nutzungseinheit (z.B. Wohneinheit,
Gewerbeeinheit) angeschlossen sind, und
- der hydraulische Durchmesser des
senkrechten Teils der Abgasanlage höchstens 0,15 m beträgt, und
- der senkrechte Teil der Abgasanlage höchstens
einmal bis zu 30° schräggeführt (gezogen) ist, und
- die untere Reinigungsöffnung nicht mehr
als 15 m von der Mündung entfernt ist, und
- die Umlenkung in den senk-rechten Teil
durch einen Bogen mit einem Biegeradius gleich oder größer dem
Durchmesser des senkrechten Teils der Abgasanlage erfolgt und
- bei seitlicher Anordnung der Reinigungsöffnung
im Verbindungsstück diese höchstens 0,3 m vom senkrechten Teil entfernt
ist oder
- bei Anordnung der Reinigungsöffnung an der
Stirnseite eines geraden Verbindungsstücks diese höchstens 1,0 m von der
Umlenkung in den senkrechten Teil entfernt ist.
Reinigungsöffnungen in
Verbindungsstücken
In Verbindungsstücken ist mindestens eine
Reinigungsöffnung erforderlich. Reinigungsöffnungen sind an Umlenkungen größer
45° anzuordnen.
Die Abstände zwischen den Reinigungsöffnungen sollten die in der
nachfolgenden Tabelle angegebenen Werte nicht überschreiten.
Maximaler Abstand zwischen
Reinigungsöffnungen in Abhängigkeit vom Brennstoff und der Anordnung
Gegebenenfalls ist eine weitere Reinigungsöffnung
in der Nähe der Feuerstätte erforderlich, wenn Kehrrückstände nicht in die
Feuerstätte gelangen dürfen.
Reinigungsöffnungen sind nicht erforderlich in Verbindungsstücken, die zum
Zwecke der Reinigung und Überprüfung leicht und sicher de- und montierbar
sind.
| Brennstoff |
Maximaler Abstand in m
|
| Brennstoff |
bei seitlicher Anordnung
|
bei Anordnung an der Stirnseite eines
graden Abschnitts
|
| bei festen und flüssigen
Brennstoffen |
2
|
4
|
| bei gasförmigen
Brennstoffen |
4
|
4
|
Abmessungen von Reinigungsöffnungen
Die Maße der Reinigungsöffnungen im
senkrechten Teil der Abgasanlage müssen der nachfolgenden Tabelle 1, in
Verbindungsstücken Tabelle 2 entsprechen. Wird auf die obere Reinigungsöffnung
verzichtet, gilt bei Anordnung der unteren Reinigungsöffnung im Verbindungsstück
für die Abmessungen dieser Reinigungsöffnung Tabelle
1.
Bei Einhaltung der in den vorhergehenden Tabellen genannten
Mindest-Abmessungen kann davon ausgegangen werden, dass die allgemeine
baurechtliche Forderung nach einer Abgasanlage in Bezug auf die Größe dieser
Öffnung erfüllt ist. Abweichend von den bisherigen Angaben der Abmessung für
Reinigungsöffnungen sind in dieser Norm Mindestdurchmesser für runde Öffnungen
aufgenommen sowie die starren Höhen-und Breiten-Vorgaben gegen eine Mindestfläche
mit flexibleren Breiten- und Höhen- Angaben ersetzt worden.
Messöffnungen
Verbindungsstücke für messpflichtige Feuerstätten
z.B. nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz, müssen eine Messöffnung haben,
falls die Feuerstätte nicht bereits damit ausgestattet ist; diese sollte etwa
im doppelten Abstand des hydraulischen Durchmessers des Abgasstutzens hinter
diesem liegen und verschlossen werden können. Die Messöffnung darf durch zusätzliche
Wärmedämmung, Ummantelungen, Verkleidungen oder Befestigungsmittel nicht
verdeckt werden. Sie muss so zugänglich sein, dass Messungen ordnungsgemäß
ausgeführt werden können.
Fremde Bauteile und Einrichtungen
an und in Abgasanlagen
Die Funktions-, Brand- und Standsicherheit von
Abgasanlagen darf durch fremde Bauteile und Einrichtungen nicht gemindert
werden.
Sohle
Die Abführung der Abgase darf durch
Verbrennungsrückstände und Ablagerungen an der Sohle nicht beeinträchtigt
werden. Deshalb soll der senkrechte Teil der Abgasanlage eine unterhalb des
untersten Feuerstättenanschlusses angeordnete Sohle haben. Der Abstand
zwischen dieser Sohle und der Unterkante des Feuerstättenanschlusses sollte
mindestens 20 cm betragen.
Eine Sohle ist nicht erforderlich bei
- Abgasanlagen für nur vorübergehend
benutzte Feuerstätten mit einer Nennwärmeleistung von nicht mehr als 10
kW in freistehenden, eingeschossigen Gebäuden, die nur für einen vorübergehenden
Aufenthalt bestimmt sind, wie Wochenendhäuser, Unterkunftshütten,
Baubuden und Unterkünfte auf Baustellen,
- Abgasanlagen für offene Kamine der
Bauarten A und B nach DIN 18895-1, die allseitig offen sind, sowie der
Bauart A1 und C1 nach DIN 18895-3.
Ein Abstand zwischen der Sohle und der
Unterkante des Feuerstättenanschlusses bzw. des Verbindungsstückanschlusses
ist bei Abgasleitungen nicht erforderlich, wenn
- die unterste angeschlossene Feuerstätte über
eine Differenzdrucküberwachung verfügt und das Verbindungsstück überdruckdicht
ausgeführt ist, oder
- die unterste angeschlossene Feuerstätte
planmäßig mit Überdruck betrieben werden kann und das Verbindungsstück
überdruckdicht ausgeführt ist.
Einheitlichkeit von Bauarten und
zulässige Abweichungen
Die senkrechten Teile von Abgasanlagen sind
durchgehend mit einheitlichen Baustoffen, mit einheitlichen Abmessungen in
einheitlicher Bauart und lotrecht herzustellen. Davon abweichend sind zulässig:
- aus statischen oder bauphysikalischen Gründen
abschnittsweise unterschiedlich dick bemessene Wände,
- bei Abgasanlagen und Außenschalen aus
Mauersteinen, abschnittsweise unterschiedliche Mauersteine, sofern dies
aus Gründen der Wärmedämmung oder des Witterungsschutzes erforderlich
ist,
- Verlängerungen von Abgasanlagen (Baustoffe
und Abmessungen) über Dach nach dieser Norm
- Schrägführungen nach dieser Norm
Putzen, Ummanteln und Verkleiden der Außenflächen
von Abgasanlagen oder einzelnen Abschnitten sind zulässig, so weit die
Funktionsfähigkeit hiervon nicht beeinträchtigt wird.
Bei unterschiedlicher Ausführung des Verbindungsstückes und des senkrechten
Teils der Abgasanlage sind für den Anschlussbereich geeignete Formstücke zu
verwenden.
Abgasanlagen zu angrenzenden
Bauteilen aus oder mit brennbaren Baustoffen
Abgasanlagen und Schächte von Abgasleitungen
müssen von brennbaren Baustoffen so weit entfernt sein, dass an diesen bei
Nennwärmeleistung der Feuerstätten keine höheren Temperaturen als 85 °C
und bei Rußbränden im inneren von Schornsteinen keine höheren Temperaturen
als 100 °C auftreten können. Bauteile aus oder mit brennbaren Baustoffen müssen
zu den Außenflächen von Abgasanlagen mindestens einen Abstand einhalten, der
dem Zahlenwert der Abstandskiasse in mm entspricht. Die Zwischenräume
zwischen den Bauteilen aus oder mit brennbaren Baustoffen und der Abgasanlage
sind mit nichtbrennbaren Baustoffen mit geringer Wärmeleitfähigkeit auszufüllen
oder zu belüften bzw. durchgehend offen zu halten.
Ist der Wärmdedurchlasswiderstand der
Bauteile aus oder mit brennbaren Baustoffen größer als 2,5 m2 * K * W~1 oder
sind die Bauteile außenseitig entsprechend wärmegedämmt ist der Abstand zu
belüften, sofern nicht anderweitig z. B. nach nachgewiesen wird, dass bei
Nennwärmeleistung die Temperatur an den Bauteilen 85° C und bei Rußbränden
im Inneren von Schornsteinen 100°C nicht überschreitet.
Der Wärmeleitkoeffizient der Baustoffe, die
zur Ausfüllung der Zwischen räume verwendet werden, sollte < 0,04 W * m-1
* K 1 bei 20° C betragen.
Im übrigen gelten abhängig von Bauart und
Betriebsweise nachfolgende ergänzenden Regelungen:
Abstände von Schornsteinen zu
brennbaren Bauteilen
Für Schornsteine, deren Abstandskiasse C50
oder kleiner beträgt, genügt gegenüber Holzbalken und Bauteilen
entsprechender Abmessungen aus brennbaren Baustoffen ein Abstand von
mindestens 2 cm. Zu Bauteilen, die nur mit geringer Fläche an Schornsteine
angrenzen, wie Fußleisten oder Dachlatten, benötigen diese Schornsteine
keinen Abstand, wenn diese Bauteile außenseitig frei liegen oder außenseitig
nicht zusätzlich wärmegedämmt sind.
Zwischenräume in Decken sind mit
nichtbrennbaren Baustoffen mit geringer Wärmeleitfähigkeit auszufüllen.
Zu Holzbalkendecken, Dachbalken aus Holz,
weichen Bedachungen und ähnlichen, streifenförmig an Schornsteine
angrenzenden Bauteilen aus oder mit brennbaren Baustoffen ist kein Abstand
erforderlich, wenn die Schornsteine im Bereich dieser Bauteile zusätzlich mit
mindestens 11,5 cm Mauerwerk verkleidet sind.
Abstände von Abgasleitungen oder
von Schächten für Abgasleitungen zu brennbaren Bauteilen
Abgasleitungen in Schächten mit
Feuerwiderstandsklasse L30 oder L90
Bei Temperaturklassen bis T 160 ist zwischen
den Schächten und angrenzenden Bauteilen aus oder mit brennbaren Baustoffen
kein Abstand erforderlich.
Bei Temperaturklassen bis T 200 ist kein
Abstand zu angrenzenden Bauteilen aus oder mit brennbaren Baustoffen
erforderlich, wenn die Schächte aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen, der
Zwischenraum zwischen Abgasleitung und Schacht dauernd hinterlüftet ist und
der Abstand zwischen Abgasleitung und Schacht
- bei rundem lichten Querschnitt der
Abgasleitung im Schacht mit rechteckigem Querschnitt mindestens 2 cm
- bei rundem lichten Querschnitt der
Abgasleitung im Schacht mit rundem Querschnitt mindestens 3 cm und
- bei rechteckigem lichten Querschnitt der
Abgasleitung im Schacht mit rechteckigem lichten Querschnitt mindestens 3
cm
beträgt. Die Größe der Lüftern- und
-austrittsöffnungen für die Hinterlüftung muss mindestens der durch die
vorstehend festgelegten Abstände sich ergebenden Querschnittsfläche
entsprechen.
Bei Temperaturklassen über T 200 ist
nachzuweisen, dass an den Bauteilen aus oder mit brennbaren Baustoffen keine höheren
Temperaturen als 85°C auftreten können. Der Nachweis ist entbehrlich für
Temperaturklassen bis T 400, wenn:
- der Zwischenraum zwischen Abgasleitung und
Schacht nach Absatz 2 hinterlüftet ist und von den Außenflächen des
Schachtes zu Bauteilen aus oder mit brennbaren Baustoffen 5 cm Abstand
eingehalten werden, oder der Wärmedurchlasswiderstand des Schachtes
mindestens 0,12 m2 * K * W~1 beträgt und von den Außenflächen des
Schachtes zu Bauteilen aus oder mit brennbaren Baustoffen ein Abstand von
mindestens 5 cm eingehalten werden.
Abgasleitungen für Unterdruck mit
Feuerwiderstandsdauer L90 oder L30
Abgasleitungen mit einer
Feuerwiderstandskiasse L90 benötigen bei einer Temperaturklasse bis T120
keinen Abstand zu Bauteilen aus oder mit brennbaren Baustoffen, im Übrigen
gelten die Festele-gungen dieser Norm.
Abgasleitungen außerhalb von Schächten
Abgasleitungen außerhalb von Schächten müssen
von Bauteilen aus oder mit brennbaren Baustoffen einen Abstand von 20 cm
einhalten. Es genügt ein Abstand von mindestens 5 cm, wenn die Abgasleitungen
mit mindestens 2 cm dickem nichtbrennbaren Dämmstoffen ummantelt sind oder
wenn die Abgastemperatur der Feuerstätten bei Nennwärmeleistung nicht mehr
als 160 °C beträgt.
Abgasleitungen mit Abgastemperaturen über
T300 sind mit nichtbrennbaren Dämmstoffen mit einer Dicke von mindestens 2 cm
zu ummanteln. Auf die Dämmung darf verzichtet werden, wenn der Abstand
mindestens 40 cm beträgt.
Abstände von Reinigungsöffnungen
zu brennbaren Baustoffen
Bauteile aus oder mit brennbaren Baustoffen müssen
von Reinigungsöffnungen in Schornsteinen mindestens 40 cm entfernt sein; es
genügt ein Abstand von 20 cm, wenn ein Schutz gegen Wärmestrahlung vorhanden
ist. Bauteile aus oder mit brennbaren Baustoffen müssen von Reinigungsöffnungen
in Abgasleitungen oder in Schächten für Abgasleitungen bei Temperaturklassen
bis T160 mindestens 5 cm, bei Temperaturklassen T160 < T400 mindestens 20
cm Abstand einhalten.
Fußböden aus brennbaren Baustoffen unter
Reinigungsöffnungen von Schornsteinen sind durch nichtbrennbare Baustoffe zu
schützen, die nach vorn mindestens 50 cm und seitlich mindestens je 20 cm über
die Öffnungen ragen.
Abstände von Verbindungsstücken
zu brennbaren Bauteilen
Zwischen Verbindungsstücken für Feuerstätten
mit festen Brennstoffen und Bauteilen aus oder mit brennbaren Baustoffen ist
ein Abstand von mindestens 40 cm einzuhalten. Es genügt ein Abstand von 10
cm, wenn die Verbindungsstücke mindestens 2 cm dick mit nicht brennbaren Dämmstoffen
ummantelt sind. Bei Verbindungsstücken für Feuerstätten mit flüssigen oder
gasförmigen Brennstoffen genügt bei Abgastemperaturen > 160°C und 400°C
ein Abstand von mindestens 20 cm, > 85°C und < 160°C ein Abstand von
mindestens 5 cm, bei Abgastemperaturen bis 85°C ist kein Abstand
erforderlich.
Verbindungsstücke mit Temperaturklassen über
T 300 sind gegenüber hochwärmegedämmten Wänden (Wärmedurchlasswiderstand
> 2 (m2 * K * W-1) sowie Decken aus oder mit brennbaren Baustoffen zur
Verminderung derWärmeabstrahlung mindestens 2 cm dick mit nichtbrennbaren Dämmstoffen
zu ummanteln. Auf die Dämmung darf verzichtet werden, wenn der Abstand
zwischen Abgasleitung und den Wänden sowie Decken mehr als 0,4 m beträgt.
Für Verbindungsstücke, welche die
Anforderungen an Schornsteine mit einer Feuerwiderstandskiasse L90 erfüllen,
sind abweichend von Absatz 1 und Absatz 2 die Abstände zu Bauteilen aus oder
mit brennbaren Baustoffen nach dieser Norm einzuhalten.
Für Verbindungsstücke aus Bauprodukten für
Abgasleitungen gelten die Abstände zu brennbaren Bauteilen entsprechend
dieser Norm.
Wanddurchführung von
Verbindungsstücken
Verbindungsstücke müssen, so weit sie durch
Bauteile aus oder mit brennbaren Baustoffen führen,
- in einem Abstand von mindestens 20 cm mit
einem Schutzrohr aus nichtbrennbaren Baustoffen versehen sein oder
- so weit aufgrund der Materialeigenschaften
zulässig in einem Umkreis von mindestens 20 cm mit nichtbrennbaren
Baustoffen mit geringer Wärmeleitfähigkeit ummantelt sein. Andere
Bauausführungen sind möglich, wenn die sichere Benutzbarkeit
nachgewiesen wurde.
Abweichend hiervon genügt ein Abstand von 5
cm, wenn die Abgastemperatur der Feuerstätten bei Nennwärmeleistung nicht
mehr als 160 °C betragen kann oder Gasfeuerstätten eine Strömungssicherung
haben.
Abstände von Luft-Abgas-Systemen
zu brennbaren Bauteilen
Bauteile aus oder mit brennbaren Baustoffen müssen
zu Luft-Abgas-Systemen einen Abstand einhalten, der mindestens dem durch den
Zahlenwert der Abstandskiasse der Abgasleitung in mm gegebenen Abstand
entspricht.
Für Luft-Abgas-Systeme mit einer
Abstandskiasse < C50 genügt gegenüber Holzbalken und Bauteilen
entsprechender Abmessungen aus brennbaren Baustoffen ein Abstand von
mindestens 2 cm. Bauteile, die nur mit geringer Fläche an Luft-Abgas-Systeme
angrenzen, wie Fußleisten oder Dachlatten, benötigen keinen Abstand.
Luft-Abgas-Systeme mit einer
Feuerwiderstandskiasse L90 benötigen bei Abgastemperaturen bis 120 °C keinen
Abstand zu Bauteilen aus oder mit brennbaren Baustoffen.
Für konzentrische Verbindungsstücke zu und
von Luft-Abgas-Systemen gelten die in dieser Norm festgelegten Abstände
sinngemäß.
Bei den in der Norm genannten Abmessungen oder
Abständen sind die Rundungsregeln anzuwenden. Es kann auf die jeweils
angegebene signifikante Stelle gerundet werden.
Beispiel:
3m entspricht 2,5m bis 3,4m; 3,0 m entspricht
2,95 m bis 3,04 m; 3,00 m entspricht 2,995 bis 3,004 m.
Der 2. Teil der Ausführungen über die DIN 18
160 Teil 1 folgt in einer der nächsten Ausgaben.
Für die intensivere Einarbeitung in die Norm
bieten wir natürlich demnächst wieder Schulungen an. Dies ist nötig, dass
die teilweise massiven Änderungen zu der alten DIN 18 160 Teil 1 und 2, die
in diesen Bericht wegen des Umfangs nicht beschriebenen Hintergründe und
auftretenden Probleme besprochen und aufgearbeitet werden können.
Quelle: http://www.zds-schornsteinfeger.de/Hefte2002/TechnikMaerz2002.html