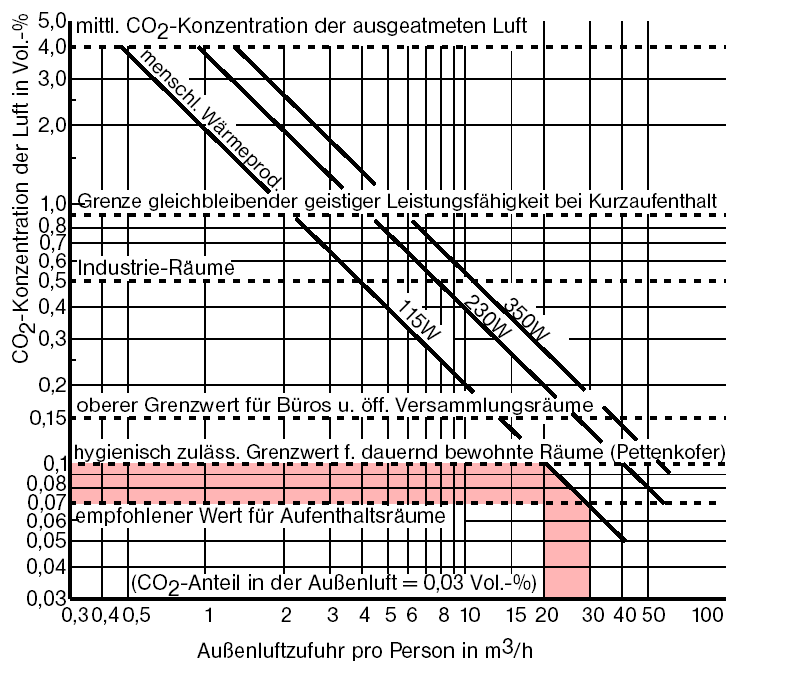
| zurück | bautagebuch | bauteam | planung | kosten | grundlagen | technik | lüftung | neu | basics | impressum | gästebuch | kontakt |
Auch wenn prinzipiell alle in Innenräumen auftretenden Luftbelastungen die Lufthygiene bestimmen, sind die Basisfaktoren die CO2-Belastung und der Anstieg der Luftfeuchtigkeit, die durch den Menschen und seine Tätigkeiten bestimmt werden. Sogenannte "schlechte Luft" wird nicht durch einen Mangel an Sauerstoff hervorgerufen, sondern in erster Linie durch eine überhöhte CO2-Konzentration. Diese Erkenntnis geht schon auf Max von Pettenkofer im Jahre 1858 zurück. Die Außenluft weist eine CO2-Konzentration von 0,03 Volumen-% auf. Der Mensch atmet die Luft mit einer CO2-Konzentration von ca. 4 Volumen-% wieder aus. Ohne Austausch mit der Außenluft würde die CO2-Konzentration in bewohnten Räumen schnell ansteigen. Eine überhöhte CO2-Konzentration ist nicht unmittelbar gesundheitsgefährdend, führt aber zu Müdigkeit, Konzentrationsproblemen, Unwohlsein und Kopfschmerzen.
Untersuchungen haben gezeigt, daß die CO2-Konzentration in Innenräumen 0,1 Volumen-% nicht überschreiten sollte. Erst bei einer Konzentration ab 2,5 Volumen-% tritt eine Gesundheitsgefährdung ein. Das nachfolgende Schaubild zeigt, daß eine personenbezogene Außenluftrate von 20 bis 30 m3/h bei einer Wärmeproduktion des Menschen von 115 W ausreichend ist, um eine genügende CO2-Abfuhr zu gewährleisten.
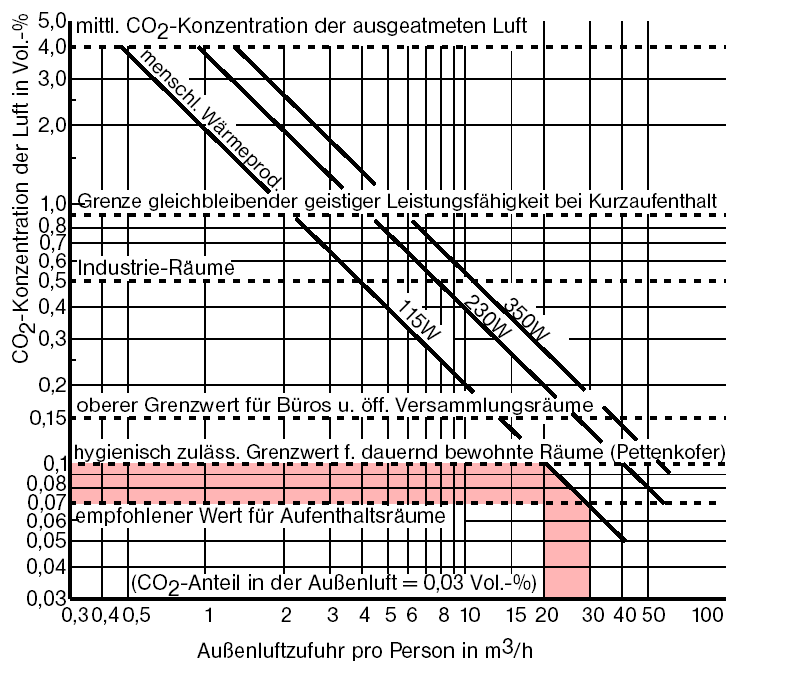
Der zur CO2-Abfuhr erforderliche Luftwechsel reicht bei kaltem Wetter im Winter aus, die Feuchtigkeit aus den Wasserdampfemissionsquellen des Hauses abzuführen, ohne dass dabei die Raumluft zu trocken wird. Zu trockene Raumluft tritt nur auf, wenn an kalten Tagen mehr als notwendig gelüftet wird oder bei undichten Gebäuden ein hoher Luftaustausch stattfindet. Da in der Übergangszeit die wärmere und feuchtere Außenluft nicht mehr so viel Wasserdampf aus der Raumluft aufnehmen kann, empfiehlt sich in dieser Zeit ein höherer als der zur CO2-Abfuhr erforderliche Luftwechsel.
Der hygienische Zustand der Luft wird ebenfalls durch deren Wasserdampfgehalt, d. h. durch die Luftfeuchtigkeit bestimmt. Die Diskussion um mangelnde oder übermäßige Luftfeuchtigkeit führt oft zu Verwirrung. Grundsätzlich ist es wichtig zu wissen, daß nicht die absolute Feuchtigkeit, nämlich der Wasserdampfgehalt in g pro kg Luft von Bedeutung ist, sondern die relative Luftfeuchtigkeit in %. Diese beschreibt das Verhältnis des tatsächlichen Wasserdampfgehaltes zu dem bei der betreffenden Temperatur maximal speicherbaren Wasserdampfgehalt. Je höher die Lufttemperatur ist, desto mehr Wasserdampf kann die Luft aufnehmen. Aus gesundheitlichen Gründen und zum Schutz der Bausubstanz wird eine relative Luftfeuchtigkeit zwischen 30 und 55 % empfohlen. Nachfolgende Grafik zeigt die Zusammenhänge zwischen absoluter und relativer Feuchtigkeit und gibt den Bereich des Luftzustandes an, der für Innenräume empfohlen wird.
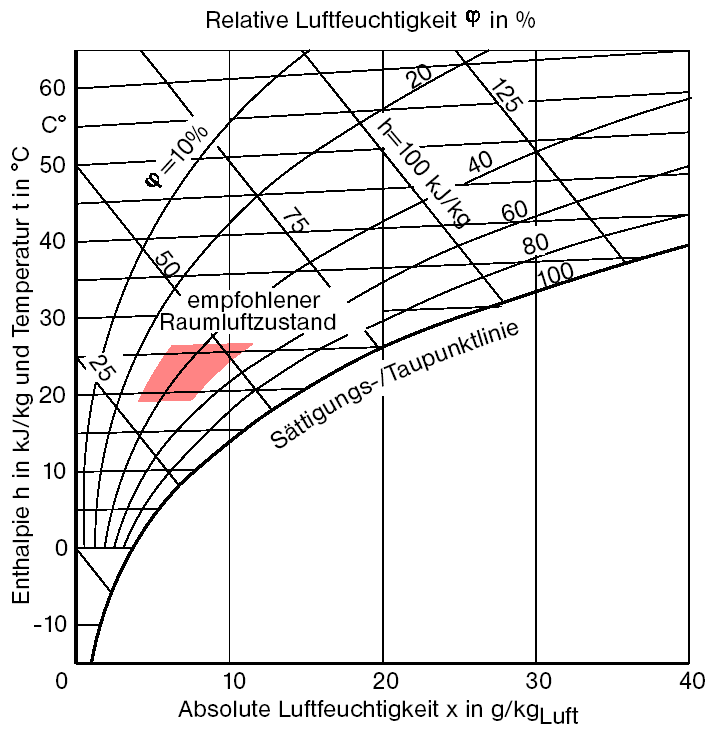
Folgende DIN-Normen müssen bei der Planung einer Lüftungsanlage (KWL) beachtet werden:
| DIN 1946 T1 | Raumlufttechnik, Terminologie und Symbole |
| DIN 1946 T2 | Raumlufttechnik, Gesundheitstechnische Anforderungen |
| DIN 1946 T6 | Raumlufttechnik, Lüftung von Wohnungen |
| DIN 4102 | Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen |
| DIN 4108 T7 | Luftdichtigkeit von Bauteilen und Anschlüssen |
| DIN 4109 | Schallschutz im Hochbau |
| DIN 4701 | Wärmebedarf, Regeln und Berechnung |
Auf weitere Normen wird später eingegangen
Die Begriffe und Definitionen sowie Darstellungen zur Lüftungstechnik sind in der DIN 1946 festgelegt. Im folgenden sind die verschiedenen Luftarten zusammengestellt. Wichtig ist hier die Betrachtung der nachfolgenden Tabelle mit den Definitionen der zu unterscheidenden Luftarten und deren Kürzel.
| Kürzel | Kennzeichnung | Farbe | Beschreibung | |
| Zuluft | ZU | Vollstrich | grün | dem zu lüftenden Raum zugeführte Luft |
| Abluft | AB | Gestrichelt | gelb | aus dem zu lüftenden Raum abgeführte Luft |
| Außenluft | AU | Strichpunkt | orange | gesamte, aus dem Freien angesaugte Luft; ehem. Frischluft |
| Fortluft | FO | Gestrichelt | gelb | gesamte, ins Freie abgeführte Luft |
| Umluft | UM | Gestrichelt | gelb | Abluft, die der Zuluft wieder zugeführt wird |
| Mischluft | Strich-Strich-Punkt | Mischung von unterschiedlichen Luftströmungen (z.B. AU- und UMLuft) |
Die Außenluftmengen, die zum Erreichen hygienischer Luftzustände erforderlich sind, werden auf zwei verschiedene Arten angegeben. Zum einen wird eine Außenluftmenge pro Zeiteinheit genannt, die zur Versorgung einer Person dient, z. B. 30 m3/h. Oder für das Haus oder die Wohnung wird ein Außenluftwechsel angegeben. Beim Luftwechsel wird die Außenluftmenge auf das anrechenbare Luftvolumen des Hauses, der Wohnung oder des Raumes bezogen; die Maßeinheit ist h-1. Die DIN 1946-6 gibt personenbezogene Außenluftmengen für verschiedene Wohnungsgrößen an. Diese entsprechen Luftwechseln von 0,6 h-1 bis 1,2 h-1. Bei mechanischer Lüftung wird vorausgesetzt, dass die Aussenluft in die bewohnten Räume einströmt, durch geeignete Überströmvorrichtungen in die belasteten Räume wie Küche und Bad gelangt und dort nach außen abgeführt wird. Treten besondere Belastungen - z. B. durch Raucher - auf, sollte der Außenluftstrom um 30 m3/h pro Person erhöht werden. In derselben Norm werden Abluftvolumenströme für fensterlose Küchen und Sanitärräume angegeben. Die Nachströmung soll ebenfalls durch Überströmung aus anderen Bereichen der Wohneinheit geschehen. Eine ausreichenden Lüftung der restlichen Räume ist allein dadurch nicht sichergestellt. An anderer Stelle werden statt der Außenluftströme Luftwechsel angegeben. Z. B. geht die WärmeschutzV '95 für den Nachweis des Lüftungswärmebedarfs von einem Luftwechsel von 0,8 h-1 aus. In der neuen Energiesparverordnung wird dieser Wert nach unten korrigiert. In anderen Regelwerken werden zum Teil abweichende Werte genannt. Die DIN 4701 (Regeln für die Berechnung des Wärmebedarfes von Gebäuden) rechnet z. B. mit einem Luftwechsel von 0,5 h-1. Weitere Veröffentlichungen gehen aus Gründen der Energieeinsparung teilweise von noch niedrigeren Luftwechseln aus. Auf der anderen Seite empfehlen namhafte Institute aus dem Bereich der Lufthygiene erheblich höhere Luftwechsel zwischen 1 h-1 und 1,5 h-1, um Feuchtigkeit, Allergene und andere Reizstoffe abzuführen, die sich negativ auf die Gesundheit auswirken können.
| Mindestaußenluft Volumenstrom Nach DIN 1946, Teil2 | ||
| pro Person [m³/h] | flächenbezogen [m³/m²h) | |
| Wohnraum | 30 | |
| Einzelbüro | 40 | 4 |
| Großraumbüro | 60 | 6 |
| Konferenzraum | 20 | 10-20 |
| Lesesaal | 20 | 12 |
| Klassen-/Seminarraum | 30 | 15 |
| Verkaufsraum | 20 | 3-12 |
| Gaststätte | 30 | 8 |
| Mindestvolumenstrom nach DIN 1946, Teil 6 für fensterlose Räume | ||
| Zuluftvolumenstrom | LWR | min. m³/h |
| Wohnen | 0,8 | 60 |
| Essen | 1,0 | 60 |
| Schlafen | 1,0 | 60 |
| Kind | 1,0 | 30 |
| Arbeiten | 0,8 | 30 |
| Hobby | 0,8 | 30 |
In den meisten Fällen wird der Lüftungsbedarf als Luftwechsel angegeben. Diese Art der Festlegung ist nicht immer sinnvoll. Beispiel: Eine dreiköpfige Familie könnte entweder ein Einfamilienhaus mit 150 m2 Wohnfläche oder eine 80 m2 große Etagenwohnung bewohnen. Ein Luftwechsel von 0,8 h-1 würde eine gesamte Luftmenge von ca. 130 m3/h für die Etagenwohnung und von ca. 240 m3/h für das Einfamilienhaus bedeuten, wobei die Innenraumbelastung nicht wesentlich größer ist. Sinnvoller wäre hier, eine zeitliche Außenluftrate pro Person von 30 bis 40 m3/h festzulegen. In diesem Fall ist jedoch zu bedenken, daß für eine größere Wohneinheit mit mehreren bewohnten Etagen ein etwas höherer Luftwechsel erforderlich ist, um eine gleichmäßige Durchströmung zu erreichen.
Die wesentlichsten Ausscheidungsstoffe unserer Lungen und unserer Haut, so weit sie in die Luft übergehen, sind Kohlensäure und Wasser. Gleichzeitig mit diesen geht stets noch eine geringe Menge flüchtiger organischer Stoffe in die Luft über, die sich bei einiger Anhäufung durch den Geruch bemerkbar machen. Für empfindsame Geruchsnerven wird jedes gewohnte Zimmer mehr oder weniger Geruch haben, so dass man anderen einem Maßstab zu verwenden hat, der uns genau gewisse Grade der Luftverderbnis ohne Mitwirkung subjektiver Empfindungen zu bestimmen erlaubt. Somit bleibt uns kein anderer Anhaltspunkt als die Kohlensäure, deren Gehalt in der freien Luft durchgehend gering ist. Der Kohlensäuregehalt allein macht die Luftverderbnis nicht aus, wir benützen ihn bloß als Maßstab, wonach wir auch noch den größeren oder geringeren Gehalt an anderen Stoffen schließen, welche zur Menge der ausgeschiedenen Kohlensäure sich proportional verhalten (Max von Pettenkofer, 1858).
Pettenkofers Gedanken haben seit mehr als einem Jahrhundert großen Einfluss auf die Lüftungsnormen in der Welt. Der Mensch wird hierbei als Hauptquelle von Luftverunreinigungen angesehen, und die erforderliche Lüftungsrate daher auf die Anzahl der im Raum befindlichen Personen bezogen. Doch eine Reihe von Untersuchungen in modernen Gebäuden haben gezeigt, dass noch viele andere Verunreinigungsquellen vorhanden sind. Jede dieser verschiedenen Quellen stellt eine auf die Raumluft wirkende Verunreinigungslast dar.
Zur Beurteilung der Raumluftqualität, wäre es wünschenswert, alle Schadstoffe und Gerüche quantitativ zu erfassen. Da dies zwar technisch möglich, die Umsetzung aber sehr aufwendig ist, ist Fanger (1990) einen anderen Weg gegangen. Um die Wirkung verschiedener Verunreinigungsquellen auf die Empfindung des Menschen darzustellen, wurden von Fanger zwei neue Einheiten eingeführt:
| Außenluftzufuhr völlig schadstofffrei | |
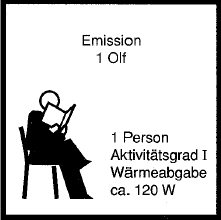 |
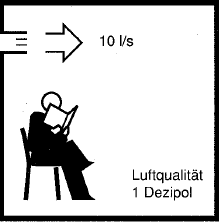 |
| Emission | Raumluftqualität |
Ein Olf [olf aus dem Lateinischen „olfactus“=Geruchssinn] bezeichnet die Verunreinigungslast einer Standardperson [Sitzende erwachsene Person mit einem Hygienestandard von 0,7 Bädern pro Tag]. Jede andere Verunreinigungsquelle[ Möbel, Teppiche und Baustoffe des Innenausbaus] kann durch die Verunreinigungslast einer entsprechenden Anzahl von Standardpersonen in Olf ausgedrückt.
Die empfundene Raumluftqualität ist abhänigig von der Anzahl und der Stärke der Verunreinigungsquellen, von der lüftungsbedingten Verdünnung der Raumluft und subjektiven Faktoren. Ein Dezipol [„pol" aus dem latainischen pollutio = Verunreinigung] wird als Einheit für die empfundene Luftqualität definiert, die durch eine Standardperson (1 olf) in einem Raum verursacht wird, der mit 10 l/s reiner Luft belüftet wird. Die Größen Olf und Dezipol können die empfundene Luftqualität hinreichend genau beschreiben und sind vergleichbar mit anderen physikalischen Größen.In der DIN 1946-T2 Anhang A werden für drei Qualitätsniveaus die empfundene Raumluftqualität in Abhängigkeit des Anteils unzufriedener Personen angegeben.
| Luftqualität | dezipol | Unzufriedene Personen [%] |
| Hoch | 0,7 | > 10 |
| Mittel | 1,4 | > 20 |
| Niedrig | 2,5 | > 30 |
Eine Verdeutlichung der Anwendung von Olf und Dezipol gibt die folgende Grafik:
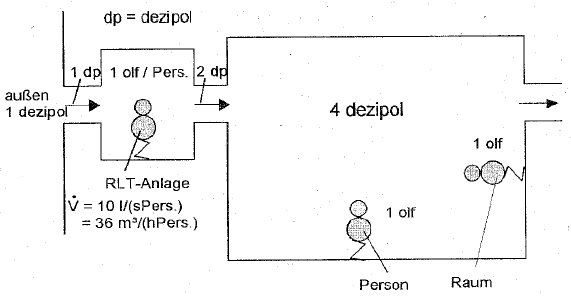 nach Fitzner/Finke 1995
nach Fitzner/Finke 1995
Die Brandschutzanforderungen an Schächte, Luftleitungen und Brandschutzklappen richten sich nach den Bestimmungen der LBO. Es muß entweder durch die Lüftungsleitungen selbst oder in Verbindung mit anderen Bauteilen verhindert werden, daß Feuer und Rauch in andere Geschosse oder Brandabschnitte übertragen werden. Anforderungen an die Feuerwiderstandsdauer von Lüftungsleitungen und Brandschutzklappen sind in der DIN 4102 T 6 festgelegt. LBO und DIN 4102 T 6 haben das Ziel: zu Verhindern, daß Feuer und Rauch in andere Geschosse oder Brandabschnitte übergehen kann. Besondere Beachtung der Brandschutzvorschriften gelten im Miet- und Geschosswohnungsbau.
Der Schalldruckpegel der Anlage sollte in Zulufträumen nicht über 25 dB (A), in Räumen der Abluft- oder Überströmzone nicht über 30 dB (A) liegen. Die nach DIN 4109 zulässigen Grenzwerte für Geräuschpegel aus Lüftungsanlagen sind unvertretbar hoch, denn bei lüftungstechnischen Anlagen sind 35 dB (A) zulässig, wenn es sich um Dauergeräusche ohne auffällige Einzeltöne handelt. Zuwischen Lüfter und Auslass- bzw. Ansaugdüsen einer KWL-Anlage müssen auf jeden Fall Schalldämpfer eingebaut werden.
| Absorptions-Schalldämpfer |
|
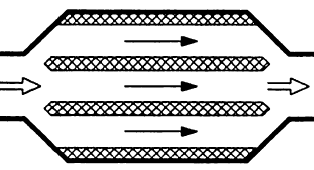 |
| Relaxions-Schalldämpfer |
|
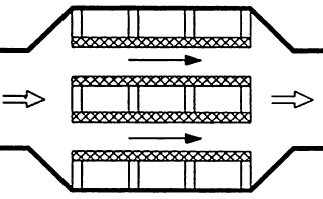 |
|
Resonanzabsorptions-Schalldämpfer
|
|
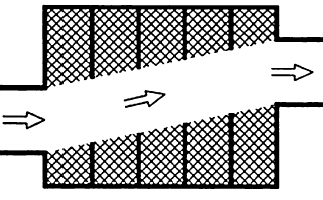 |
| Telefonie-Schalldämpfer |
|
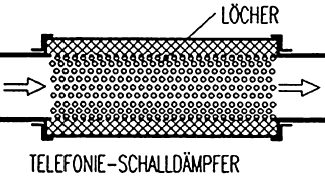 |
Geräuschquellen bei LüftungsleitungenGeräuschquellen bei Lüftungsleitungen sind vor allem die Pfeif- und Zischgeräusche, die durch Luftreibung an den Kanalwandungen (A) und durch Wirbelbildung bei Richtungsänderungen an Ecken und Kanten (B), an Übergängen (C ) und Abzweigen (D), ferner bei den Luftdurchlässen (Zu- und Abluftgitter, E) entstehen. Geräusche in Kanälen rufen auch Vibrationen hervor, die als Körperschall in das Bauwerk übertragen werden können. Dies kann z.B. durch federnde Rohrabhängungen verhindert werden.EinfügungsdämmungDie Einfügungsdämpfung kann je nach Anforderungsniveau schon durch gute Raumluftdurchlässe erreichtwerden. Vor Auswahl und Dimensionierung der Schalldämpfer sollte daher die Eigendämpfung der Anlagenteile ermittelt werden, damit keine Überdimensionierung stattfindet. |
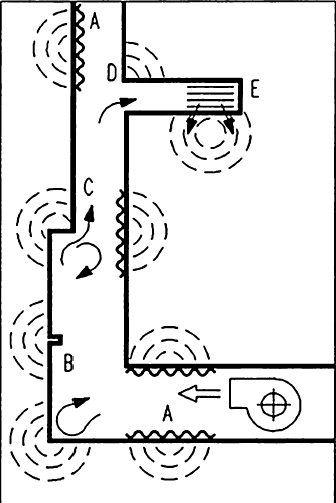 |
Ein Ausgangspunkt für die Entwicklung dezentraler Lüftungsgeräte waren hohe Lärmbelastungen in Innenstädten und in der Nähe von Autobahnen und Flughäfen. Zunächst sollte eine Möglichkeit geschaffen werden, ohne Öffnen der Fenster zu lüften und dabei das gleiche Schalldämm-Maß wie bei geschlossenen Fenstern zu erzielen. Schalldämmlüfter ohne mechanischen Antrieb werden im Fensterrahmenbereich eingesetzt. Möglich ist auch der Einsatz im oberen Teil des Fensters oder in Form eines Fensterbankgerätes. Der Antrieb des Luftaustausches erfolgt wie bei einem geöffneten Fenster durch Temperaturunterschiede zwischen Innen- und Außenluft oder durch Windanfall. Die mögliche Luftmenge kann durch Verstellen der Luftöffnungen verändert werden. Der Außenschall wird gemindert, indem ähnlich wie in Schalldämpfern der Schall durch ein poröses Material, mit dem der Lüfter innen ausgekleidet ist, absorbiert wird. Häufige Umleitung der Luft innerhalb des Gerätes führt ebenfalls zu einer Verminderung des Schalldruckpegels.
Moderne Schalldämmlüfter sind wärmegedämmt, so dass der Wärmedämmstandard des Fensterrahmens nicht verschlechtert wird. Da der Luftaustausch sehr stark von den äußeren klimatischen Bedingungen abhängt, werden Schalldämmlüfter häufig zusätzlich mit Ventilatoren versehen.Für den nachträglichen Einbau stehen auch kleine Wandgeräte zur Verfügung, bei denen die Luft über einen Außenwanddurchbruch von ca. 80 mm Durchmesser angesaugt wird. Das Geräusch der Ventilatoren muss so niedrig sein, dass die Bewohner - besonders in der Nacht - nicht gestört werden.
Dezentrale Lüftungsgeräte mit Wärmerückgewinnung werden z. B. in neuen Gebäuden mit dichter Gebäudehülle zur Lüftung des Badezimmers eingesetzt oder in einem Wohnzimmer, in dem regelmäßig geraucht wird. Im Baubestand von Mehrfamilienhäusern wurden mit nachträglich installierten Einzelraumgeräten große Erfolge zur Vermeidung von Feuchteschäden erzielt. Hier treten nach einer Sanierung mit dichteren Fenstern oft Feuchteprobleme an Kältebrücken auf. Eine dauerhafte Lüftung der entsprechenden Räume mit Wärmerückgewinnung schafft ohne übermäßigen Wärmeverlust wieder hygienische Luftzustände. Angenehm wirkt sich während des Betriebes der Geräte die leichte Vorwärmung der Außenluft durch die Wärmerückgewinnung aus. Einzelraumgeräte zur Lüftung sollten an einer Außenwand in der Nähe des Fensters angebracht werden. Um Zugerscheinungen im Aufenthaltsbereich von Personen zu vermeiden, werden sie entweder im oberen Fensterbereich bzw. im oberen Teil der Außenwand oder als Fensterbankgerät mit der Ausblasrichtung auf den darunterliegenden Heizkörper installiert. Die Geräte können entweder auf die Wand aufgesetzt oder in die Wand eingelassen werden.
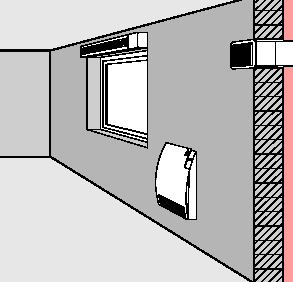
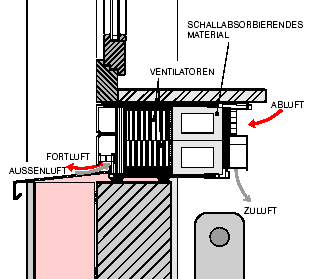
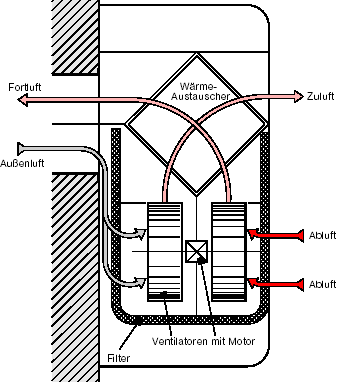
Einzelraumlüftungsgeräte eignen sich besonders für einen nachträglichen Einbau. Werden die Geräte nicht in das Fenster integriert, ist ein Wanddurchbruch mit 80 bis 150 mm Durchmesser notwendig. Die Außenluftansaugung bzw. der Abluftauslass wird durch ein Lamellengitter gegen Eindringen von Regenwasser geschützt. Im Gerät selber kann es zur Kondensation der warmen, feuchten Innenluft kommen. Deshalb muss ein geeigneter Kondensatablauf vorhanden sein. Teils wird das Kondensat in den Außenluftstrom geleitet. Beim Einsatz eines Einzelraumlüftungsgerätes darf nicht außer acht gelassen werden, dass trotz guter Wärmedämmung des Gerätes der Dämmstandard der Außenwand nicht erreicht wird. Das Gerät ist nur sinnvoll eingesetzt, wenn es den Mindestluftaustausch des Raumes kontinuierlich sicherstellt. Über das Fenster sollte nur noch eine Stoßlüftung erfolgen. Einzelraumlüftungsgeräte sind mit Filtern ausgestattet. Diese können einfache Grobfilter sein, um das Eindringen von Insekten zu verhindern. Ist ein Wärmeaustauscher vorhanden, wird dieser mit feineren Filtern vor Verschmutzung durch die Außen- und Innenluft geschützt, die auch das Eindringen von Staub und Pollen in den Raum reduzieren. Bei kontinuierlichem Betrieb sollten die Filter alle drei bis sechs Monate gewechselt werden. Alle zwei Jahre ist das gesamte Gerät gründlich zu reinigen. Bei vielen Geräten lassen sich zu diesem Zweck die Wärmeaustauscher herausnehmen. Wenn nicht mit kalter Luft eingeblasen werden soll - z. B. im Badezimmer - kann ein Gerät mit einer elektrischen Nachheizung niedriger Leistung eingesetzt werden. Neben einer manuellen Steuerung ist es möglich, die Luftmenge über einen Thermostaten oder einen Hygrostaten zu regeln. Ersterer begrenzt die Luftmenge bei sinkender Außentemperatur, während zweiterer die Luftmenge in Abhängigkeit von der Innenraumfeuchte regelt. Je nach Ausführung ist bei dezentralen Lüftungsgeräten mit Wärmerückgewinnung mit Gerätekosten von 300 bis 2 000Eur zu rechnen; hinzu kommen die von den Einbauverhältnissen abhängigen Installationskosten.
Die Zuluft muss so in den Raum eingebracht werden, dass es nicht zu Zugerscheinungen (bedingt durch zu hohe Luftgeschwindigkeiten oder Turbulenzen) in der Aufenthaltszone kommt. Bei der Auslegung von Zuluftöffnungen ist somit dafür Sorge zu tragen, daß die Lage und das Strömungsverhalten der verwendeten Komponenten auch bei maximaler Leistung der Lüftungsanlage, Luftgeschwindigkeiten über 0,2 m/s innerhalb der Aufenthaltszone ausschließen. Es wird hier unterschieden zwischen
Einfluß auf Wurfweite: Zulufttemperatur > bei erhöhter Temperatur erhöht sich die Wurfweite; bei geringerer Temperatur verringert sie sich.
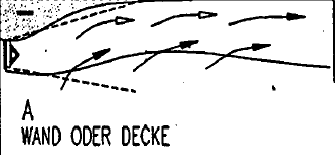
| Plattenluftverteiler |
|
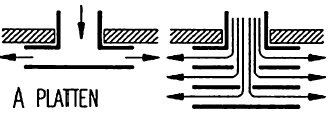 |
| Quatratische Luftverteiler |
mit pyramidenförmig angeordneten Lamellen
|
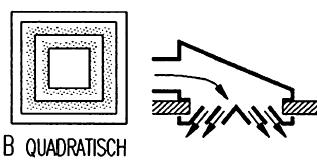 |
| Kombinierte Zu- und Abluftdurchlässe | 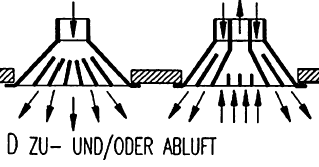 |
|
| Tellerventile |
|
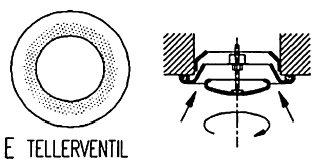 |
| Düsenluftauslässe |
|
 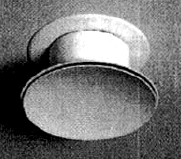 |